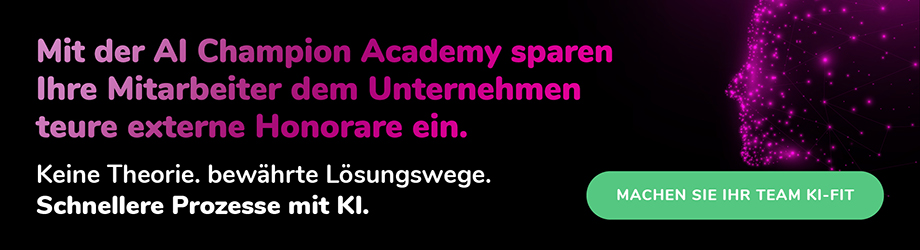Die Entwicklung des HanseWerk-Speichers Kraak begann 1992 mit gezielten Solungen, bei denen Wasser Salz auflöst und Kavernen erzeugt. Seit der Inbetriebnahme der ersten Kaverne im Jahr 2000 wurde das System auf aktuell rund 202 Millionen Kubikmeter Kapazität erweitert. In dieser Zeit sicherte der Speicher kontinuierlich das Jahresvolumen von circa 120.000 Haushalten. Auf der Feier zum 25-jährigen Bestehen am 30. September loben Minister und Branchenvertreter die geologische Eignung und langjährige Betriebssicherheit.
Inhaltsverzeichnis: Das erwartet Sie in diesem Artikel
Speichervolumen deckt jährlich Bedarf von rund 120.000 Haushalten verlässlich
Der Prozess zur Untertagelagerung von Erdgas im Salzstock unterhalb der Kraaker Tannen nutzt seit 1998 die Solung, um Kavernen zu schaffen. Dabei wird Wasser unter hohem Druck eingeleitet, das Salz löst sich auf und bildet hohlraumartige Strukturen mit einem Gesamtvolumen von 202 Millionen Kubikmetern. Diese Speicherkapazität entspricht dem Bedarf von etwa 120.000 Haushalten pro Jahr. Die erste Kaverne wurde im Jahr 2000 in Betrieb genommen und anschließend stetig kontinuierlich erweitert.
Kraak-Speicher bleibt unverzichtbarer Anker der Gasversorgung dank digitaler Steuerung
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert betont Dr. Benjamin Merkt, technischer Vorstand der HanseWerk-Gruppe, die herausragende Zuverlässigkeit des Kavernenspeichers Kraak, der Norddeutschland seit 25 Jahren mit durchgehend hoher Verfügbarkeit und sicherem Betrieb versorgt. Er unterstreicht, dass der Speicher selbst in stabilen Marktphasen geschätzt werde, weil seine digitale Steuerung Automatisierung und Prozessoptimierung schnelle sowie präzise Reaktionen auf Nachfrageänderungen ermöglichen und Versorgungssicherheit garantieren. Merkt bezeichnet Kraak als unentbehrlichen digitalen Anker für eine Energiezukunft.
Minister Blank betont Dekarbonisierungspotenzial im Kavernenspeicher Kraak für Wasserstoff
Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Dr. Wolfgang Blank identifiziert den Kavernenspeicher Kraak als potenziellen Wasserstoffspeicher im Rahmen der Dekarbonisierungsstrategie. Ines-Experte Sebastian Heinermann erläutert, wie digitale Prozessleittechnik, hohe Systemstabilität und optimierte Automationskonzepte die Effizienz maximieren und herausragende Betriebsflexibilität gewährleisten, wodurch der Speicher als Versorgungsanker fungiert. Zugleich bestätigen Alexander Kattner vom Bergamt Stralsund und Amer Abdel Haq von UGS, dass die geologischen Strukturen und Salzqualität des Salzstocks exzellente Voraussetzungen für die Lagerung neuer Molekültypen bieten.
Erste Kaverne nahm 2000 Betrieb auf, Solungen seit 1992
Bereits 1992 wurden mittels Solungen großvolumige Hohlräume geschaffen, indem unter hohem Druck Wasser Salz im Untergrund auflöste. Dieses Verfahren legte die Grundlage für den ersten Speichertunnel, der am 27. September 2000 offiziell aktiviert wurde. In nachfolgenden Jahren folgten zusätzliche Solungen und umfangreiche Erweiterungen der gastechnischen Infrastruktur, wodurch die Speicherkapazität des Kavernenspeichers schrittweise auf rund 202 Millionen Kubikmeter anstieg. Diese Entwicklung wurde durch präzise Planung, Technik, Monitoring sowie effiziente Steuerung begleitet.
Kavernenhöhen bis 177 Meter überragen Schweriner Dom um sechzig Meter
In einer Fläche von etwa sieben Kilometern Länge und viereinhalb Kilometern Breite liegt ein mächtiger Salzstock, dessen Sedimentschichten von 400 bis 4.700 Metern Tiefe unter der Erdoberfläche verlaufen. Auf einer Tiefe von circa 1.000 Metern wurden in die massive Salzstruktur Kavernen mit Höhen bis 177 Meter eingetragen, was sie um etwa 60 Meter über das Schweriner Domdach hinauswachsen lässt. Diese Kombination sichert Dichtigkeit und dauerhafte Speichersicherheit auch bei wechselnden Betriebsbedingungen.
HanseWerk-Studien bestätigen Salzstocks Eignung für künftige Wasserstoffspeicherung und Diversifizierung
Sämtliche aktuellen Forschungsarbeiten von HanseWerk stellen die Eignung des Kraak-Salzstocks für Wasserstoffspeicherung heraus und bestätigen exzellente Dichtigkeit sowie konsistente Salzbeschaffenheit. Trotz dieser positiven Bewertung existieren keine finalen Entwürfe für die Implementierung der Technologie. Die Datengrundlage speist sich aus einem Vierteljahrhundert Erfahrungen im Gasbetrieb und bildet die Ausgangslage für vertiefende Untersuchungen. Insgesamt bleibt die Option einer kombinierten Gas- und Wasserstofflagerung unter den gegebenen Rahmenbedingungen realistisch und zukunftsweisend und unterstützt die Energiewirtschaft.
Salzstockbasierte Lagerung ermöglicht künftiges Wasserstoffpotenzial und stärkt deutliche Infrastruktur-Resilienz
Der Salzstock unterhalb der Kraaker Tannen beherbergt seit 25 Jahren den Kavernenspeicher Kraak, der in etwa 1.000 Metern Tiefe Hohlräume mit bis zu 177 Metern Höhe nutzt. Die robuste Salzgeologie garantiert langfristige Dichtheit für mehr als 200 Millionen Kubikmeter Gas, was den Energiebedarf von etwa 120.000 Haushalten absichert. Mit digitaler Prozesssteuerung und adaptiver Druckregelung vereint die Anlage Effizienz, Flexibilität und Versorgungssicherheit und bietet zudem Potenzial für Wasserstoffintegration. Ermöglicht energetische Zukunftsoptionen.